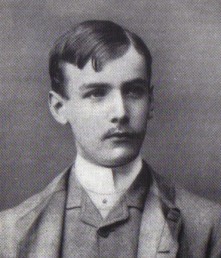Person
Ort
Thema
Walter Sachs
Thüringer Literaturrat e.V. / Die Reihe »Gelesen & Wiedergelesen« entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.
Wiedergelesen von Walter Sachs
Harry Graf Kesslers Tagebücher aus den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen gleichen einer Perlenkette aus vielen Begegnungen mit höchst unterschiedlichen Menschen, die subtil zu charakterisieren der Autor nicht müde wird. Als Diplomat ist Kessler direkt ins politische Zeitgeschehen involviert. Seine Aufzeichnungen aus der persönlichen Sicht des Beteiligten, geben aufschlussreiche Einblicke in die Beziehungen der Europäischen Staaten nach dem 1.Weltkrieg und in die ihrer Protagonisten. Seine Vorschläge zur Reform des Völkerbundes haben mit Blick auf die EU kaum an Aktualität verloren. Kessler konstatiert ein Erstarken des Nationalismus, das Schwächeln der Sozialdemokratie, die europäische Uneinigkeit und mangelnde Bereitschaft zur Solidarität, das ist voll trauriger Parallelen zu dem, was heutige Zeitungen melden. Die Frage nach Diktatur oder Demokratie, ein neues sozialeres Gesellschaftskonzept jenseits des Kapitalismus, die Alltagskultur, aber auch die Frage, wie es in Kunst, Literatur, Musik, Tanz und Theater weitergehen soll, sind es, die den polyglotten Grafen umtrieben.
Qua Geburt mit beachtlichem Vermögen ausgestattet und mit Verbindungen in die höchsten Kreisen der Gesellschaft, war es ihm möglich, sich derart vielseitig zu engagieren. Bei allem Sinn fürs Elitäre ist Kessler die immer größer werdende Kluft zwischen Armen und Reichen nicht nur suspekt, sondern moralisch zuwider. Mit Breitscheid besichtigte Kessler am 28.12.1918 das beschädigte Berliner Schloss und reflektiert über den schlechten Geschmack und die schlechte Politik des vertriebenen Kaisers – und über den Zusammenhang zwischen ästhetischen und politischen Defiziten: „Aus dieser Umwelt stammt der Weltkrieg oder was an Schuld am Weltkrieg den Kaiser trifft: aus dieser kitschigen, kleinlichen, mit lauter falschen Werten sich und andere betrügenden Scheinwelt seine Urteile, Pläne, Kombinationen und Entschlüsse. Ein kranker Geschmack, eine pathologische Aufregung die allzu gut geölte Staatsmaschine lenkend! Jetzt liegt diese nichtige Seele hier herumgestreut als sinnloser Kram. Ich empfinde kein Mitleid, nur, wenn ich nachdenke, Grauen und ein Gefühl der Mitschuld, daß diese Welt nicht schon längst zerstört war, im Gegenteil in etwas anderen Formen überall noch weiterlebt.“
Kessler wendet sich ebenso den Fragen des Neuaufbruches von Kunst und Kultur zu. Nach einem Gespräch am 23.03.1919 mit Hellmuth Herzfelde (John Heartfield), fasst Kessler dessen Forderungen zusammen: „ … daß er und seine Freunde immer feindlicher der Kunst gegenüberständen. Was George Grosz und Wieland (Herzfelde) machten, sei zwar Kunst, aber sozusagen nur nebenbei. Die Hauptsache sei der Puls der Zeit, die große Gemeinschaft, in der sie mitschwinge. Er lehnt jede alte Kunst, auch wenn sie in ihrer Zeit gerade diese Eigenschaft der Modernität gehabt habe, ab. Sie wollten keine Dokumente schaffen, nichts was Bestand habe und den Nachkommen im Wege stehe.“ Bei all seiner Sympathie für die damalige (nun wieder aktuelle) Modernität, die die tagespolitische Aktion voran stellt, bewahrt Kessler doch stets den geschulten Blick und eine hohe Wertschätzung für das, was eben nicht nur „nebenbei“ Kunst ist, „was Bestand“ hat. Davon zeugen seine feinsinnigen Kommentare zu Werken der Antike, zur Gotik und zur Kunst seiner Zeitgenossen.
Zum Erhalt der Buchkunst im besten Sinne des Wortes setzt Kessler einen großen Teil seines Vermögens für die Cranach-Presse in Weimar ein. Er lässt extra eine neue Schrift (Gill) entwickeln, um in der Gestaltung des Textes mit den Illustrationen das Buch-Kunst-Werk als ein in sich geschlossenes Ganzes entstehen zu lassen. Für die Eklogen des Vergil bittet er Maillol nicht nur um Holzschnitte, sondern auch um die Initialen.
Auch, wer sich ein bißchen für den Alltag der Künstlerszene, um nicht zu sagen: den kultivierten Klatsch und Tratsch, der Zwanziger und beginnenden Dreißiger Jahre interessiert, kommt auf seine Kosten. Zu vielen Künstlern, Literaten, Musikern, Tänzern und Schauspielen hielt Kessler persönliche Kontakte aufrecht, besonders aber zu Aristide Maillol, den er, nicht nur um seiner Kunst willen, besonders schätzte. Wiederholt von schwerer Krankheit heimgesucht, und in all seinen begonnenen Vorhaben zunehmend unter finanziellen Druck geraten, schmerzt ihn der nötig gewordene Verkauf einer großen Plastik Maillols besonders, die er einst für seine, von van der Velde eingerichtete Berliner Wohnung, erworben hatte. Nach der Machtergreifung der Nazis kehrt Harry Graf Kessler nicht mehr in sein Haus Cranachstraße 15 in Weimar, ja überhaupt nicht mehr nach Deutschland zurück.