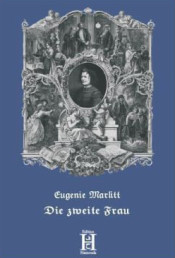Personen
Orte
Thema
Cornelia Hobohm
Thüringer Literaturrat e.V. / Die Reihe »Gelesen & Wiedergelesen« entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.
Wiedergelesen von Cornelia Hobohm
Alle Vielleser kennen es: Die meisten literarischen Werke, also auch jene, die begeisterten, die berührten, liest man nur ein einziges Mal. Im festen Vorsatz, das Buch noch einmal in die Hand zu nehmen, tut man genau dieses lediglich beim Staubwischen. Zu groß ist das Verlangen, sich neuen Lesestoff anzueignen und Unbekanntes zu erschließen. Dabei wissen wir doch ganz genau, dass eine wiederholte Lektüre zu einem späteren Zeitpunkt zu anderen, gelegentlich überraschenden Einsichten und Ansichten führen kann, sowohl in positiver als auch in negativer Wertung des Werkes. Warum also sollte man einen Roman einer Autorin des 19. Jahrhunderts rezipieren, die noch dazu über fast ein Jahrhundert hinweg einen eher zweifelhaften Ruf als reine Unterhaltungsschriftstellerin, als Bestsellerautorin, als Kitschtante gar genoss? Sollte man nicht die „Großen“, die Erstligisten, zurückholen und gerade sie vor der Vergessenheit bewahren? Welche jüngeren Leser begeistern sich freiwillig für Fontane, Keller, Storm, Raabe, Ebner-Eschenbach? Vorbei scheinen die Zeiten, in denen Effi Briest, Der grüne Heinrich, Pole Poppenspäler, Der Hungerpastor oder Krambambuli Allgemeingut waren, nicht Pflichtlektüre für Germanistikstudenten. Wie steht es um Karl May, um Ganghofer – oder eben um die Marlitt? Ein Versuch ist es immerhin wert, sich mit der Thüringerin auseinanderzusetzen – gerade weil sie so umstritten war, gerade weil sie beschmunzelt wurde, gerade weil sie die kommerziell erfolgreichste Autorin deutscher Sprache in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war. Sind ihre Romane, dreizehn an der Zahl, heute noch lesbar?
Es gibt einen Marlittroman, der vom üblichen Schema abweicht, der bereits zu seiner Erscheinungszeit auf erhebliche Widerstände gestoßen ist und den nicht wenige Rezipienten für den besten halten: Die zweite Frau aus dem Jahr 1874. Er ist nicht so bekannt wie Das Geheimnis der alten Mamsell (1867), nicht so beliebt gewesen wie die Goldelse (1866). Die Autorin selbst scheint mit ihm gerungen zu haben. Im Juni 1874 schreibt das Arnstädter Fräulein Friederike Christiane Henriette Eugenie John, einer stetig anwachsenden Leserschar besser bekannt unter dem Pseudonym E. Marlitt, an ihre enge Freundin und Vertraute Leopoldine von Nischer-Falkenhof nach Wien: »…und nun will ich Dir auch danken für deine Güte und Treue, mit der Du mein Schmerzenskind unter deine Flügel zu nehmen gesuchst – ein Schmerzenskind ist mir ‚Die zweite Frau‘ allerdings insofern geworden, als man sie zerzaust, zerrauft, als formlosen Rumpf auf die Bühne gezerrt und sie mit eigenmächtig hinzugefügten Gliedern hat agieren lassen…Obgleich mein neuer Roman den Lesern nun vollendet vorliegt und eine vollständig andere Entwicklung zeigt, als die Herren Spitzbuben vorausgesehen, zieht das Stück noch immer über die Bretter, und die Leute gehen hin, um die ihnen liebgewordenen Gestalten, wenn auch im kläglichen Zerrbild, verkörpert zu sehen-wohl bekomm’s ihnen!« - Ein Gesetz, das den Schutz von geistigem Eigentum und dem Autor eines Werkes dessen Recht an einer weiteren Verwertung garantiert, gab es im deutschsprachigen Raum bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts noch nicht. Bis zur Verabschiedung eines Urheberrechts 1901 konnte es demzufolge ohne rechtliche Konsequenzen geschehen, dass Bühnenfassungen von Prosavorlagen existierten, die nicht autorisiert waren. Da die Romane E. Marlitts als Fortsetzung in der Gartenlaube erschienen, unmittelbar im hauseigenen Verlag dann als Buch, war es möglich, dass Bühnenfassungen umgesetzt wurden, deren Ende in der Zeitschrift noch gar nicht gedruckt waren. Die Marlitt hatte diese Praxis bereits nach dem Erscheinen der Reichsgräfin Gisela (1869) erfahren müssen. Der Brief an die Freundin ist jedoch auch aufgrund einer weiteren Bemerkung von Interesse: Sie schreibt, dass die ‚Spitzbuben‘ die Entwicklung im Romangeschehen nicht absehen konnten. Es sei noch einmal betont, dass dieser Roman vom sonstigen Marlittschema abweicht. Die bis in die späten 80er, frühen 90er Jahre des 20. Jahrhunderts übliche Einschätzung, wonach der Leser alle Marlittromane kenne, wenn er nur einen wirklich gelesen habe, trifft auf diesen so gar nicht zu. Sehr wohl erkennen wir die bekannten Grundstrukturen und das Hauptthema der Erfolgsautorin wieder, demnach eine junge, moralisch integre, geistig äußerst bewegliche und sowohl physisch als auch psychisch belastbare Frau unter vielen Widerständen, Intrigen und Beinahe-Katastrophen ihren Weg ins Leben bahnt und am Ende mit einer Liebesheirat belohnt wird, wieder; dennoch weicht gerade dieser Roman in manchen Positionen vom vermeintlich Bekannten ab. Sein Erscheinungsjahr ist einer der Gründe dafür.
Die zweite Frau wird auf dem Höhepunkt des Bismarckschen Kulturkampfes veröffentlicht. Die Thüringer Protestantin Eugenie Marlitt, pragmatisch und lebenserfahren, bezieht in ihrem achten Prosawerk eindeutig Stellung. Auch in früheren Romanen war sie der Gretchenfrage nicht ausgewichen, stellte inhaltsleere religiöse Praktiken in Frage, verabscheute Bigotterie und Intoleranz, gleich, welcher Konfession. Mehrfach wird sie dafür kritisiert und angegriffen, unter anderem von dem evangelischen Pfarrer O. Weber, dessen zum überwiegenden Teil giftige Kritik Die Religion der ›Gartenlaube‹. Ein Wort an die Christen unter ihren Lesern sich auf die Goldelse bezieht und 1877 bereits in siebter Auflage erscheint. Doch nur der Roman Die zweite Frau kann vor dem konkreten historischen Hintergrund des Kulturkampfes gelesen werden. Dieser Begriff (›Kulturkampf‹) wurde 1873 von R. Virchow erstmals verwendet und bezeichnet heute jene Phase der Politik Bismarcks, in der dieser angestrengt und letztlich wenig erfolgreich versuchte, den Einfluss der katholischen Zentrumspartei einzudämmen sowie die Trennung von Kirche und Staat zu forcieren. So sollte beispielsweise der ›Kanzelparagraf‹ verhindern, dass Geistliche den Gottesdienst für politische Stellungnahmen missbrauchen. Der Einfluss der Kirche in den Schulen sollte deutlich gesenkt werden, die Zivilehe wurde gesetzlich bindend. Inwiefern den meisten Bewohnern innerhalb und außerhalb Preußens die Dimensionen dieser Regelungen bewusst waren, sei dahingestellt. Was sich allerdings zeigte, war deutlicher Unmut der Protestanten an den Papsttreuen, den Ultramontanen, den Jesuiten vor allem. Die Gartenlaube als auflagenstärkstes Blatt dieser Zeit schürt diesen Unmut in nicht unbeträchtlichem Maße. Was also geschieht in Marlitts Roman?
Um den privaten Bankrott, von der verschwenderischen Mutter verschuldet, zu entkommen, geht die junge Liane von Trachenberg, eines der drei Kinder des verstorbenen Grafen von Trachenberg, eine Konvenienzehe mit dem attraktiven, aber berechnenden und gefühlskalten Baron von Mainau ein. Dieser ist verwitwet und sucht keine wirkliche Ehefrau, sondern lediglich eine Erzieherin seines kleinen Sohnes Leo. Geschäftsmäßig wird die Ehe zu Beginn des Romans geschlossen und wie Geschäftspartner verhalten sich Raoul und Liane fortan auch. Doch mehr und mehr droht selbst diese Beziehung an der intriganten Umgebung des mainauschen Hofes zu zerbrechen. Der Gatte ist häufig auf Reisen, der Hof wird nicht von ihm, sondern seinem Onkel, dem Hofmarschall, sowie seinem jesuitischen Hofprediger dominiert. Beide bergen schmutzige Familiengeheimnisse und schrecken vor Lügen, Betrug und kriminellen Machenschaften keineswegs zurück. Sowohl der Hofmarschall als auch der Pater sehen sich der Protestantin Liane gegenüber moralisch überlegen. Liane kann nur allein, vorsichtig unterstützt von der nach außen grobschlächtigen Haushälterin Frau Löhn, auf die kulminierenden Anfeindungen und Diskriminierungen reagieren. Die Auseinandersetzungen gipfeln in einem Mordversuch an der jungen Frau durch den Jesuiten, nachdem dieser vergeblich sexuell handgreiflich gegenüber Liane geworden ist. Aus der Konvenienz- muss eine Liebesehe werden, will Liane ihre Pläne zur Rettung des trachenbergschen Hauses nicht aufgeben. Ihre vordergründige Aufgabe besteht fortan darin, ihrem Ehemann die kriminellen Machenschaften des Onkels und des Paters zu beweisen.
Liane ist nur nach außen hin die sprichwörtliche graue Maus, bescheiden und zurückhaltend. Wichtiger als alle Äußerlichkeiten sind ihr Selbstbewusstsein, Bildung und vor allem Aufrichtigkeit. Sie weicht als Protestantin keinen Zoll von ihren religiösen Überzeugungen ab und steht in vielen verbalen Gefechten am katholischen Hof selbst dem Pantheismus nicht allzu fern. Sie scheut weder philosophische Diskussionen mit dem Hofmarschall noch dem Pater oder der Herzogin. »Wohl wahr«, äußert Liane in einem Disput über den christlichen Glauben, »ich verstehe darunter das geheimnisvolle Walten der Naturkräfte. Die meisten unserer Mitlebenden betrachten noch immer die Natur als etwas Selbstverständliches, über das sie nicht nachzudenken brauchen, weil sie es ja sehen, hören und begreifen können – dass aber ebendieses Sehen, Hören und Begreifen das Wunder ist, fällt ihnen nicht ein. Und nun dichtet man dem weisen Schöpfer willkürliche Eingriffe in seine ewigen Gesetze an, oft nur um winziger menschlicher Interessen willen, ja, die Kirche geht noch weiter-sie lässt untergeordnete Geister dieses vollendete Gewebe zerstörend durchbrechen, lediglich, um irgendein Hirtenmädchen oder sonst eine einsame Seele von Gottes Dasein zu überzeugen, und nennt das ›Wunder‹. Wie kläglich und theatralisch aufgeputzt erscheinen sie neben Gottes wirklichem Schaffen und Walten…« – Es sind flammende Reden wie diese, die Liane beinahe ihre Stellung am katholischen Hof kosten. Es sind Worte wie diese, die die Autorin zu einem Sprachrohr von Bismarcks Kulturpolitik machen. Wie brisant diese Textpassagen gewirkt haben müssen, zeigt der Umstand, dass gerade dieser Roman in einigen katholischen Gegenden auf den Index verbotener Bücher gesetzt oder gelegentlich, wie in der französischen und der ungarischen Ausgabe geschehen, kurzerhand umgearbeitet wurde: Aus der Negativfigur des Jesuitenpaters wird ein protestantischer Geistlicher, aus der Positivfigur der Liane eine Katholikin. In der Übersetzung war die Welt für den katholischen Leser wieder im rechten Lot.
Nicht nur die eigene Betrachtungsweise religiöser Fragen, auch die Ansichten über die Stellung der Frau in der sich formierenden modernen bürgerlichen Gesellschaft gehen über das Maß dessen hinaus, was gemeinhin unter anspruchsloser Unterhaltungsliteratur verstanden wird. Der Marlitt war es wichtig, starke Frauencharaktere zu entwerfen, die in der Lage sind, sich gegenüber einer intriganten, bildungsfeindlichen oder/und bigotten Umgebung durchzusetzen. Die Heldinnen der Autorin – und ganz besonders Liane – sind lautere, starke Persönlichkeiten, die im Ernstfall, und der Ernstfall wäre hier die Ehelosigkeit, das heißt für das 19. Jahrhundert auch die Versorgungslosigkeit der Frau, materiell für sich selbst sorgen können: als Unternehmerin wie Katharina aus dem Haus des Kommerzienrates, als Archäologin wie Grete in dem Roman Die Frau mit den Karfunkelsteinen oder als Botanikerin und Erzieherin wie Liane. Diese literarischen Figuren sind durchweg positiv gezeichnet, erfahren keine oder nur sehr wenig Entwicklung und bieten sich damit als Identifikationsfiguren bevorzugt für die Leserinnen an. Wenn diese Vorzeigefrauen dann am Ende des Romangeschehens in den starken Armen des geliebten Mannes liegen und in der Liebesehe und der Gründung einer Familie die weitere Erfüllung ihres Lebens sehen, so entspricht das den Vorstellungen des Großteils der Leserschaft des 19. Jahrhunderts – und wohl auch weit darüber hinaus. Der Lohn für die Existenzkämpfe ist letztlich die Ehe, die zwischen zwei sich achtenden und liebenden Menschen geschlossen wird. Das Problem der mainauschen Ehe besteht aber darin, dass sie zu einem geschäftsmäßigen, nur äußerlich funktionierenden Gebilde degradiert wird. Liane muss sich Würde und Respekt erst im Laufe ihrer Beziehung erkämpfen. Gelänge ihr das nicht, auch das wird im Roman mehrfach betont, bedeutete dies die Scheidung.
Eugenie Marlitt schuf diese und andere Frauenfiguren ganz sicher nach ihren eigenen Erfahrungen und Wunschvorstellungen. Sie wusste, was es hieß, sich als Ledige beruflich einen Weg und damit eine Existenzsicherung suchen zu müssen. Nur mit einer Ehe wurde sie am Ende ihres Weges nicht belohnt. Das Fräulein John, 1825 als Tochter eines eher erfolglosen Kaufmannes in Arnstadt geboren und 1887 daselbst als gefeierte und verehrte Romanautorin verstorben, wurde nach ihrer Ausbildung am Sondershäuser Fürstenhof und in Wien zunächst Opernsängerin. Das sich einstellende Gehörleiden war wohl psychosomatischer Natur und verhinderte die Fortsetzung ihrer Musikerlaufbahn. Was nun? Abermals kam ihr die nunmehr geschiedene Fürstin Mathilde von Schwarzburg-Sondershausen zur Hilfe. Zehn Jahre lang war Eugenie John Gesellschafterin, Lektorin, Krankenpflegerin der Fürstin; kurzum: Mädchen für alles. Fast 40-jährig kündigt sie die Stellung und kehrt mit dem festen Vorsatz, schriftstellerisch tätig zu werden, in ihr thüringisches Vaterstädtchen zurück. Sie ist fest integriert in die Familie ihres Bruders Alfred, einem Lehrer, bewohnt mit ihm und seiner Familie ab 1871 die ›Villa Marlitt‹ am Stadtrand, die sie sich nach Auszahlung ihres Honorars für die Reichsgräfin Gisela leisten kann. Die Marlitt erlebt Anerkennung und Verehrung, aber auch kollegiale Häme und Verriss, vor allem auch Wohlstand, den sie mit der Familie teilt. Doch eine Ehe – glücklich, von bürgerlich liberalen Werten getragen, vom Partner geachtet, von Kindern umschwärmt – bleibt ihr versagt. Avancen wie die des greisen Fürsten Pückler-Muskau lehnt sie klugerweise entschieden ab. Die glückliche Ehe, in die sich ihre Romanheldinnen begeben, bleibt eine Wunschvorstellung, die Erfüllung nur für ihre Romanfiguren.
Die Romane der Marlitt sind weit entfernt davon, Heimatromane zu sein. Sie sind zwar, außer dem Heideprinzesschen, alle in Thüringen bzw. dem Thüringer Wald oder in Arnstadt und Umgebung angesiedelt, da es die Gegend ist, welche die Autorin liebt und genau kennt, also auch besonders gut nachzeichnen kann. Jedoch bildet auch darin Die zweite Frau eine Ausnahme: Schauplatz der Handlung sind zwei Schlösser und ein Jagdhaus, die auf keiner Karte zu finden sind. Die Problematik der fiktiven Bewohner ist dagegen überall zu Hause.
In Form und Stil weicht die Marlitt in diesem Werk kaum von ihrem Schema, das ja auch ein Garant für ihren Erfolg war, ab. Zwar verzichtet sie, wohl eher unbewusst, auf Anthropomorphisierungen und auf allzu häufige Diminutiva, die letztlich dazu beitragen, die Diktion als kitschig zu empfinden. Doch auch dieser Roman wird von zum Teil gelungenen, zum Teil redundant erscheinenden Landschafts- und Witterungsschilderungen getragen, von genauen Zeichnungen bestimmter Äußerlichkeiten der Figuren, so zum Beispiel der steten Betonung von Lianes rotem Haar, das manchmal Bewunderung, manchmal den Spott in ihrer Umgebung auslöst, aber auch für ihre Widerspenstigkeit und Eigenwilligkeit steht. Viele Figuren sind typisiert, Nebenfiguren stehen häufig für Volkstümlichkeit und jenen gesunden Menschenverstand, den man bei den aristokratischen Gegenspielern so häufig vermisst. Diese Nebenfiguren können bei Marlitt aber auch den Schleier des Exotischen, damit des Geheimnisvollen, Nebulösen tragen, so wie die ›Bajadere‹, die im ›indischen Haus‹ auf dem mainauschen Anwesen ihrem Tod entgegendämmert und ihr Geheimnis, dessen Entdeckung sowohl den Hofmarschall als auch dessen Komplizen, den Pater, schwer belasten und diffamieren würde, ins Grab zu nehmen droht.
Marlitts Roman Die zweite Frau ist auch gut 140 Jahre nach seinem Erscheinen durchaus lesbar. Er steht in einer Traditionsreihe anderer deutschsprachiger bürgerlich-realistischer Literatur, deren Autoren heute so häufig der Vorwurf des Provinziellen gemacht wird. Provinzialität meint hier Engstirnigkeit, Kleingeistigkeit. Sehr zu Unrecht. Denn wenn Storm oder Raabe oder Keller oder auch die Marlitt einen Ausschnitt aus ihrer Gegenwart beleuchten, dann erfassen sie nicht nur die Wirklichkeit von Husum oder Braunschweig oder Zürich oder Arnstadt, sie erfassen damit auch immer ein Stück der Wirklichkeit über diese begrenzte Region hinaus; sonst wären sie nicht so massenhaft gelesen worden. Damit vermögen sie es tatsächlich, ein jeder mit seinen literarischen Mitteln und Möglichkeiten, zwar nicht die große weite Welt, aber doch ihre gesamte Umgebung im Wassertropfen zu spiegeln. Auch Die zweite Frau vermag den Leser noch immer zu berühren, zu bewegen. Das fiktive singuläre Schicksal dieser jungen Frau aus dem 19. Jahrhundert kann den Leser von heute noch in seinen Bann ziehen. Was lässt sich Schöneres über ein literarisches Werk aussagen?
Angemerkt sei noch, dass der originale und ungekürzte Text aller Marlittromane lediglich in der Gartenlaube sowie den nachfolgenden Buchausgaben aus dem Verlag Ernst Keil bzw. Ernst Keils Nachfolger nachzulesen ist. Alle anderen Ausgaben unterlagen und unterliegen zum Teil drastischen Kürzungen. Das Geheimnis der alten Mamsell sowie Die zweite Frau erschienen 2009 dagegen ungekürzt und nur in der Orthografie angeglichen im Leipziger Verlag Edition Hamouda. Die Zitate folgen dieser Ausgabe. Der Monolog, der Lianes Sicht auf die Religion spiegelt, fehlt beispielsweise in fast allen Ausgaben, die zwischen 1900 und 2009 erschienen sind. Der Kaiser Verlag Klagenfurt äußerte Anfang der 90er Jahre starke Bedenken, Die zweite Frau in ihrer Marlittromanreihe erscheinen zu lassen. Die Begründung: Die Autorin kritisiere die katholische Kirche zu stark, das könne den österreichischen Leser verprellen. Gemeint sind die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts.