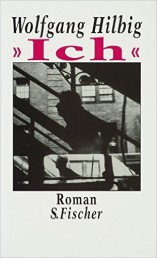Personen
Thema
Ralf Eggers
Thüringer Literaturrat e.V. / Die Reihe »Gelesen & Wiedergelesen« entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.
Wiedergelesen von Ralf Eggers
Vor einigen Jahren zeigte ein westdeutscher Freund in einem ostdeutschen Literaturkreis Urlaubsdias. Die berüchtigte Form kleinbürgerlicher Gemütlichkeit zeitigte einen heilsamen Erinnerungsschock. Denn jener Freund, ein engagierter Linker, hatte in den frühen Achtzigern die DDR bereist – und dabei fotografiert, was wir niemals fotografiert hatten: Bewohnte Ruinen, schäbige Auslagen, absurde Propaganda, den ganzen alltäglichen Verfall. Die ostdeutsche Frau des Vortragenden fasste unseren Eindruck zusammen. »Bitte sagt, dass es nicht so schlimm gewesen ist!« Dass die DDR, was immer man politisch über sie sagen muss, so scheiße aussah, hatten wir vergessen.
In Wolfgang Hilbigs Texten sieht die DDR als Kulisse eher noch schlimmer aus: zerstört, verwüstet, vergiftet, stinkend. Das hat sicherlich mit Hilbigs Berufsbiographie zu tun. Wer als Heizer und in der Braunkohle arbeitete, sah das Land anders als ein Akademiemitglied. Woran auch immer wir uns erinnern, an das Paradies der eigenen Jugend, den Schauplatz der ersten Liebe, an schlechten Rotwein oder die erste Westplatte, an das Land der verpassten Chancen oder meinetwegen an ein Straflager: In dem Land, das Wolfgang Hilbig uns zeigt, würde man nicht Urlaub machen, geschweige denn leben wollen. Die Häßlichkeit der DDR, die wie wahre Schönheit von innen kam, ist so einprägsam vielleicht erst wieder anhand der Küchenabfälle in Lutz Seilers Kruso geschildert worden.
Rezensenten haben zu Hilbigs Werk wiederholt vermerkt, dieser Autor verweigere seinem Leser »Erlösung«, worunter man sich offenbar ein Happy End als schmackhaftes Dessert vorstellt. Damit konnte er in der Tat nicht dienen. Wären seine Texte Lebensmittel, müsste man sie sich als das Gegenteil von kulinarisch wertvoller Kost vorstellen – zu fett, zu scharf, zu ungesund. In »Ich«, seinem 1993 erschienen und bei weitem umfangreichsten Text, findet sich viel davon, der Dreck, die soziale Verwahrlosung im Ostberlin der Achtziger, die auch eine Stadt der Säufer, der Gestrandeten, der vergessenen Alten und geistig Verwirrten war. Man könnte Hilbigs Bücher mit den Urlaubsfotos meines Freundes illustrieren.
»Ich« berührte bei seinem Erscheinen 1993 eine offene Wunde. Es war die Zeit, in der DDR-Bürger verkraften mussten, dass ihr Land nicht nur hässlich, sondern auch von systematischer Denunziation überzogen war. »Stasi« war (neben »Mauer«) Anfang der Neunziger der Kampfbegriff zur DDR-Bewältigung, auf den sich fast alle einigen konnten. Zugleich verlangte der Feuilleton gebieterisch (als hätte er etwas zu gebieten) den ultimativen DDR-Roman, eine Untergattung, von der es ja mittlerweile eher zu viel als zu wenig gibt. Hilbig, ein Autor, der nicht nach dem Markt und schon gar nicht nach Lesbarkeit schielte, hatte mit einem Buch gleich zwei Volltreffer gelandet – einen DDR- und einen Stasiroman. Die Geschichte des Stasiinformanten und verhinderten Autors Cambert und seines Gegenspielers, des nonkonformistischen Lyrikers und Operativen Vorgangs »Reader« ist ein spannender, wenn auch vielleicht etwas unterkomplexer Plot. Beim Wiederlesen konnte ich mich allerdings nicht des Eindrucks erwehren, dass ein Roman nach klassischen Kompositionsregeln nicht Wolfgang Hilbigs Form war. Sein an der Lyrik geschulter Stil ist nicht gemacht für Erzählung, Spannung und Figurenentwicklung. So dicht und expressiv diese Prosa ist, so schwerblütig wirkt sie über mehrere hundert Seiten. Aber das ist nur ein formaler Einwand und zudem Geschmackssache. Das Hauptproblem scheint mir beim heutigen Wiederlesen zu sein, dass Wolfgang Hilbig, der die Stasi zu hassen allen Grund hatte, versucht hat, sie zu literarisieren. Das beginnt mit albernen Kalauern (oder wie er schreiben würde »vollbärtigen Witzen«) wie dem Stasimann Wasserstein, der sich Feuerbach nennt. Das setzt sich fort in einer Sprachkritik (die Genitivketten), die man schon anderswo gelesen hat. Und das endet in düsterer Symbolik, mit der die Stasi zugleich dämonisiert und entlarvt werden soll (die endlosen Kellerwanderungen des Stasispitzels, sein unterirdischer Stützpunkt in der Normannenstrasse). Die Literarisierung der Stasi zeigt zwar ihrer Perfidie, nicht aber ihre Banalität. So viel Sprachkunst tut einem so schäbigen Gegenstand zu viel Ehre an. Man könnte vielleicht sagen, die Stasi sei ein zu schwacher Gegner für den großen Dichter Wolfgang Hilbig gewesen.
Erstausgabe des S. Fischer Verlages, Frankfurt am Main 1991.