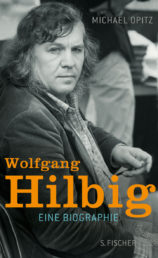Personen
Ort
Thema
Dietmar Jacobsen
Thüringer Literaturrat e.V. / Die Reihe »Gelesen & Wiedergelesen« entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.
Gelesen von Dietmar Jacobsen
Ein Weltliterat aus Meuselwitz
Wolfgang Hilbigs (1941–2007) Werk zieht mittlerweile eine lange Reihe von Sekundärliteratur hinter sich her. Kaum ein Text dieses Dichters, der, obwohl er der Arbeiterklasse entstammte und als Schriftsteller Autodidakt war, in der auf Arbeiterliteratur nachgerade versessenen DDR dennoch nicht verlegt wurde, blieb unbeachtet, kein Vers unkommentiert. Und dennoch fehlte bis dato ein Gesamtblick auf das Leben des aus dem thüringischen Meuselwitz stammenden Autors.
Dieses Desiderats hat sich nun der 1953 in Berlin (Ost) geborene Literaturwissenschaftler und ‑kritiker Michael Opitz mit der ersten umfangreichen Biographie Hilbigs angenommen. Er hat Freunde und Lebensgefährtinnen des Dichters um Einblicke in ihre Briefwechsel mit Hilbig gebeten, sich in die neun Aktenordner, die das Ministerium für Staatssicherheit im Laufe von mehr als zweieinhalb Jahrzehnten über den ungeliebten Autor füllte, vertieft und sich den in 46 Archivkästen bei der Akademie der Künste gesammelten Dichternachlass – eine wahre Fundgrube für alle an Wolfgang Hilbigs Werk Interessierten – genau angeschaut. Entstanden ist dabei eine akribisch aus den Quellen gearbeitete, Leben und Werk ineins setzende, umfangreiche Studie, die das Zeug zum Standardwerk besitzt.
Opitz nähert sich einem der sprachmächtigsten deutschsprachigen Autoren der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in sechs großen Kapiteln, von denen jedes noch einmal in fünf Unterkapitel zerfällt. Als Überschriften sämtlicher Abschnitte hat er durchgängig Zitate aus Hilbigs Texten gewählt. Damit wird von vornherein unterstrichen: Der Mann und sein Werk sind genauso wenig zu trennen wie die Welt seiner Bücher von derjenigen seines familiären und geografischenHerkommens. Wer Hilbig verstehen will, ohne dessen Gedichte, Erzählungen, Romane und theoretischen Einlassungen einzubeziehen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn Leben und Schreiben dieses Mannes waren praktisch eines. Jenseits seiner Schriftstellerexistenz existierte zwar die »Privatperson« Wolfgang Hilbig, doch zu deren Kern drang kaum jemand durch. Und diejenigen, denen es gelang, den Menschen hinter dem Autor kennenzulernen, bezahlten diese Nähe nicht selten mit Leid und Erschütterung.
Natürlich ist es die Kindheit Hilbigs, aus der sich vieles in Hinsicht auf seine spätere Außenseiterrolle – im Literaturbetrieb wie im gesellschaftlichen Leben – erklärt. Da sein Vater an der Ostfront geblieben war, übernahm der Großvater mütterlicherseits, Kasimir Startek, der in den 20er Jahren als Bergarbeiter aus seiner ostpolnischen Heimat nach Meuselwitz gekommen war, dort geheiratet und sich niedergelassen hatte, das Amt des Erziehers. Er tat dies mit harter Hand und – da er selbst Deutsch weder lesen noch schreiben konnte – ohne Rücksicht auf das besondere Talent seines Enkels, das sich bereits in dessen Schulzeit andeutete.
Als Volksschüler schrieb Hilbig Wildwest- und Abenteuergeschichten im Stile der damals von Hand zu Hand gehenden Buffalo Bill -Heftchen. Ob man diese frühen literarischen Versuche, die das Renommee des 13-/14-Jährigen unter seinen Mitschülern deutlich aufbesserten, tatsächlich, wie Opitz das tut, als eine erste Phase in Hilbigs Gesamtwerk ansehen kann, scheint mir deren Bedeutung – Hilbig selbst hat einen Großteil der Texte, die vor 1965 entstanden, später vernichtet – ein wenig zu hoch zu veranschlagen. Immerhin fehlte dem sich mehr und mehr dem Schreiben zuwendenden jungen Mann, der nach Abschluss der achten Klasse eine Facharbeiterausbildung als Bohrwerkdreher absolvierte und anschließend in verschiedenen Berufen arbeitete, von denen der des Heizers literarisch am deutlichsten zu Buche schlug, von Anfang an sowohl das familiäre Verständnis wie auch die familiäre Unterstützung für jene Richtung, in die sich sein Leben ab dem Ende der 50er Jahre entwickelte.
Trotzdem ging Hilbig konsequent den einmal eingeschlagenen Weg, der um die Mitte der 60er Jahre herum dann zu Gedichten und Erzähltexten führte, die sich von den romantisch inspirierten Erzählungen – Einflüsse von Novalis und E.T.A.Hoffmann sind deutlich nachweisbar – der späten 50er/frühen 60er Jahre absetzten und die Gegenwart als ihr Thema entdeckten – eine Gegenwart allerdings, die in Hilbig Werken immer unterkellert ist von jenen Räumen, in denen die Schrecken deutscher Vergangenheit nur darauf zu warten scheinen, wieder hervorzubrechen.
Dass er es mit solcherart Texten und der Art und Weise, wie er in ihnen Arbeiterleben zu einer einzigartig artifiziellen Sprache brachte, in einem »Arbeiter-und-Bauern-Staat«, als den sich die offizielle DDR verstand, nicht leicht haben würde, war von vornherein absehbar. Die Tatsache, dass bis zu dem epochalen historischen Einschnitt in der deutschen Nachkriegsgeschichte, den die Jahre 1989 und 1990 darstellten, eine einzige selbständige Publikation von Wolfgang Hilbig in der DDR erschien – der von Franz Fühmann entscheidend mit auf den Weg gebrachte Band Stimme Stimme 1983 im Leipziger Reclam-Verlag -, spricht in dieser Hinsicht Bände.
Im selben Zeitraum wuchs die Zahl seiner im S. Fischer Verlag Frankfurt/Main seit 1979 erscheinenden Bücher auf sechs: zwei Gedicht‑, drei Erzählungsbände und der Roman Eine Übertretung (1989). Hält man sich dies vor Augen, erscheint die Zuordnung Hilbigs zu dem Komplex »DDR-Literatur« zumindest problematisch und rechtfertigt sich höchstens dadurch, dass fast alle seine – auch die nach 1990 geschriebenen und publizierten – Texte ihre Orte im deutschen Osten, meistens zwischen Meuselwitz, Leipzig und Berlin – die bei ihm zu M., L. und B. verkürzt wurden -, den Stätten also, an denen Hilbig den Großteil seines Lebens verbrachte, besaßen. Ihn für die Welt der Literatur entdeckt und entsprechend gefördert zu haben, können sich freilich am ehesten der Frankfurter Verlag, dem er bis zum Ende seines Lebens treu blieb, und sein erster Lektor Thomas Beckermann auf die Fahnen schreiben – es ist dies kein geringes Verdienst.
Natürlich gefielen Hilbigs Westpublikationen weder der ihn seit 1964 observierenden Staatssicherheit – seine mehrwöchige Untersuchungshaft von Mai bis Juli 1978 hatte allerdings weniger mit seinem Schreiben zu tun, wurde aber von der Stasi auch zu Verhören genutzt, in denen nach seinen Westkontakten und befreundeten literarischen Kreisen in der DDR gefragt wurde – noch all jenen Kulturverantwortlichen, die in Ministerien, Verlagen, Bildungseinrichtungen und Medien fleißig am Bild einer den Aufbau des Sozialismus auf ihre Weise unterstützenden DDR-Literatur bastelten. Bemerkenswert aber ist der Mut, mit dem sich der junge und von seinem Werk überzeugte Autor immer wieder gegen Kritik an seinem Schreiben und die zahllosen Versuche, den literarischen Außenseiter entweder zu disziplinieren oder mundtot zu machen, zur Wehr setzte.
Michael Opitz‹ umfangreiche Lebensbeschreibung führt zu den Quellen von Wolfgang Hilbigs einzigartig in der neueren deutschen Literatur dastehendem Werk. Der mit Hilbigs Texten detailliert vertraute Autor verfolgt die Genese von immer wieder in Gedichten, Erzählungen und Romanen auftauchenden Themen, Motiven, Bildern und Figuren. Lektüren, die ihren Einfluss hinterließen, werden namhaft gemacht, Hilbigs poetischer Ansatz, der Literatur als übersetzte erlebte Realität begriff, an zahlreichen Beispielen verdeutlicht.
Dass Hilbig im Unterschied zu Zeitgenossen und Schriftstellerkollegen wie Volker Braun, Heiner Müller oder Christa Wolf zu keinem Zeitpunkt seines Lebens an die Reformierbarkeit des in der DDR praktizierten Sozialismus glaubte – er, mit Opitz‹ Worten, den Bitterfelder Weg in die andere Richtung beschritt -, machte ihn zu jener Kaspar-Hauser-Existenz, als der er sich, wie einige Stellen in seinem Werk belegen, selbst verstand. Wer Hilbigs opus magnum, den Roman Das Provisorium (2000) gelesen hat, weiß, dass sich an dieser Situation auch nach seiner Ausreise in die Bundesrepublik im November 1985 nicht änderte. Wolfgang Hilbig war und blieb ein Außenseiter. Heimisch zu werden gelang ihm weder in den utopischen Gefilden eines Staatssozialismus, in dem Versprechen und Realitär immer weiter auseinanderdrifteten, noch in den Hallen einer Warenwelt, die alle Bedürfnisse zu befriedigen wusste, nur nicht jenes nach einem sinnerfüllten, lebenswerten Dasein, wie er es suchte und letztlich nur am Schreibtisch fand.
- Michael Opitz: Wolfgang Hilbig. Eine Biographie. Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag 2017, 663 Seiten, 28,- Euro, ISBN 978–3‑10–057607‑1
Abb.: S. Fischer Verlag.